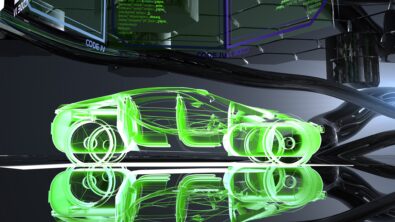Digitalisierung und die Zukunft des Vehicle Performance Engineering (Folge 7)
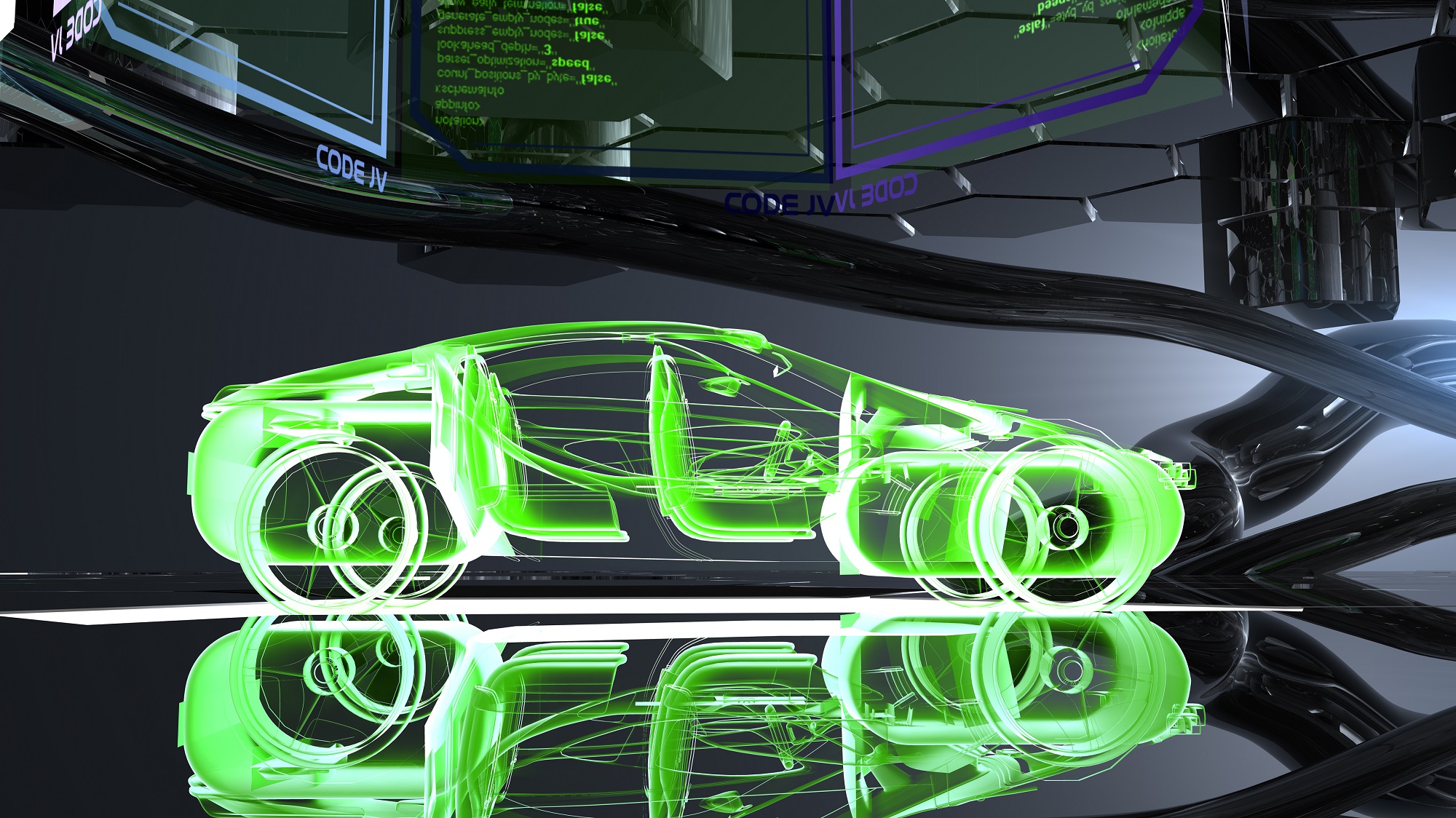
Welche Perspektiven bietet der digitale Zwilling für die Automobilbranche?
Wie optimieren Sie Ihre Produktentwicklung und treffen von Anfang an die richtigen Entscheidungen?
Wird er physikalische Tests überflüssig machen?
Gewiss streben manche Hersteller danach, Tests komplett durch Simulationen zu ersetzen, um Entwicklungszeiten zu straffen und Kosten zu reduzieren. Doch würde es auch den gewünschten Effekt erzielen?
Erwartungsgemäß gibt es auf diese Fragen keine einfachen Lösungen. Um den aktuellen Stand der Digitalisierung und Simulation in der Automobilindustrie zu beleuchten und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen, hat Alexander Heintzel, Chefredakteur von ATZ International, zwei Experten zu einem Gespräch eingeladen.
Steven Dom ist Director of Automotive Industry Solutions bei Simcenter, und Tom Van Houcke ist Director of Engineering and Consulting Services bei Simcenter.
Sie haben einen Podcast produziert, der für alle im Bereich Digitalisierung und Fahrzeug-Performance-Engineering unverzichtbar ist.

Was ist ein digitaler Zwilling?
Es gibt unterschiedliche Auffassungen davon, was einen digitalen Zwilling ausmacht. Also startet Steven den Podcast mit seiner Definition aus der Sicht von Simcenter und der Automobilbranche.
Er bezeichnet es als „die bestmögliche digitale Abbildung des Fahrzeugs, die in jeder Entwicklungsphase als Computermodell erstellt wird“. Hierbei kann es sich um ein konzeptionelles Modell für eine frühe Systemsimulation, ein detailliertes CFD-Modell oder ein aus Testdaten generiertes Modell handeln.
Steven betont, dass trotz fortschrittlicher Simulationsmöglichkeiten in frühen Entwicklungsphasen Prüfungen in der Praxis nach wie vor unverzichtbar bleibt. Und er glaubt nicht, dass sich das in nächster Zeit ändern wird.
„Man kann nicht alle Aspekte simulieren, besonders angesichts neuer Technologien und Konzepte in der modernen Fahrzeugentwicklung.“
Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz
Tom unterstreicht die Schlüsselrolle von Machine Learning und KI für die Zukunft der Simulation. „Erstausrüster wissen, dass sie auf umfangreiche historische Daten aus Tests und Feldeinsätzen zurückgreifen können. Diese lassen sich durch maschinelles Lernen optimieren oder zur Modellbildung nutzen.“ Mit zunehmender Datenerfassung, -speicherung und Rechenleistung wird es möglich sein, noch umfassendere digitale Zwillinge in Echtzeit zu nutzen und mit Tests zu kombinieren, erläutert er.
Künstliche Intelligenz wird diesen Vorgang zwar erleichtern, doch es bedarf weiterhin menschlicher Steuerung und Kontrolle. „Wenn man nichts Ordentliches eingibt, kommt nur Müll heraus“, sagt er. „Ingenieure benötigen nicht nur Anwendungswissen, sondern auch ein tiefgreifendes Verständnis der ML-Technologie, um Daten optimal zu analysieren und zu nutzen.“
Er betont zudem, dass diese Technologie der Schlüssel zur flächendeckenden Einführung autonomer Fahrzeuge sein könnte: „KI kann zur Definition des Fahrverhaltens eingesetzt werden, was die Entwicklung autonomer Fahrzeuge unterstützt und deren Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit möglicherweise erhöht.“
Entdecken Sie mehr zu KI im Fahrzeugbau in Joelle Beuzits Fachblog.
System- und Prozessintegration
Steven betont, dass Fahrzeuge des vergangenen Jahrhunderts über weitgehend isolierte Systeme verfügten, was sich jedoch – insbesondere mit dem Aufstieg der Elektromobilität – grundlegend gewandelt hat. „Der Elektromotor, das Getriebe und die Leistungselektronik sind nun in einem kompakten Gehäuse vereint und existieren nicht mehr als separate Einheiten“, erläutert er.
Er erläutert, wie all diese Komponenten viel enger zusammenarbeiten müssen, um Konflikte zu vermeiden und die Effizienz zu maximieren: „Sonst haben Sie am Ende drei getrennte Kühlsysteme statt einem einzigen.“
Die Simulation ist der Schlüssel, um die Entwicklung dieser verschiedenen Bereiche im sogenannten Model-based System Engineering (MBSE) zusammenzuführen. Steven und Tom sprechen über die damit verbundenen Herausforderungen und darüber, wie sich Unternehmen optimal aufstellen können, um dies zu erreichen.
Wird ein BMW immer noch ein BMW sein?
Alexander wirft die Frage auf, wie sich neue Entwicklungsprozesse, E-Antriebe und autonomes Fahren auf das Endprodukt auswirken und ob Fahrzeuge jene Alleinstellungsmerkmale behalten werden, die sie von anderen unterscheiden.
Das ist ein interessanter Punkt, da viele Kunden markentreu sind und erwarten, dass sich die moderne Version ihres Autos wie die traditionelle „anfühlt“. Steven und Tom sprechen über die Auswirkungen von Neuerungen in der Automobiltechnik und darüber, wie Hersteller gewährleisten können, dass ihre Produkte ihre „Identität“ bewahren.
Erfahren Sie die gesamte Geschichte
Es ist ein spannendes Gespräch, das all diese Fragen und mehr umfasst. Hören Sie sich den kompletten Podcast hier an.
- Das Potenzial des digitalen Zwillings in der Fahrzeugentwicklung und seine Grenzen
- Die Rolle und die Anforderungen an den effizienten Einsatz von KI und maschinellem Lernen
- Wie Sie die Systemintegration steuern und ein höheres Effizienzniveau erreichen
- Wie Zusammenarbeit und Prozessintegration helfen, die Gesamtkomplexität zu bewältigen
- Wie Model-Based Systems Engineering (MBSE) hilft, die Entwicklung zu optimieren
- Vorteile eines Prozessmanagementsystems als Backbone
- Die Zukunft der Markenabgrenzung
- Die zentrale Rolle der „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ bei autonomen Fahrzeugen
- Ist es klug, einen Autonomie-Level zu überspringen? Und werden autonome Fahrzeuge eine Evolution oder eine Revolution darstellen?
Alexander Heintzel:
Hallo und willkommen beim heutigen Podcast. Wir sprechen mit zwei Experten von Siemens Digital Industries Software und heißen Steven Dom, Direktor für Automobilindustrie-Lösungen bei Simcenter, sowie Tom Van Houcke, Direktor für Simcenter Konstruktions- und Beratungsdienste, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
Steven Dom und Tom Van Houck:
Hallo.
Alexander Heintzel:
Ich hoffe, Sie sind gut in Form, denn heute beschäftigen wir uns eingehend mit Digitalisierung und Vehicle Performance Engineering. Damit komme ich direkt zum ersten Thema. Digitalisierung und virtuelle Simulation sind derzeit bekanntlich in aller Munde. Sprechen wir also über Chancen und Grenzen, über die Vision und die aktuelle Realität. Steven, was können Simulation und digitaler Zwilling bei der Entwicklung, Erprobung und Validierung der funktionalen Sicherheit bewirken?
Steven Dom:
Zunächst sollten wir klären, was genau unter einem digitalen Zwilling zu verstehen ist, da es hierzu verschiedene Auffassungen gibt. Ich stelle gerne den Rahmen dafür und erläutere dann kurz, was wir unter einem digitalen Zwilling verstehen, wenn Sie möchten.
Steven Dom:
Ein digitaler Zwilling ist in der Fahrzeugentwicklung die bestmögliche digitale Abbildung des zu entwickelnden Fahrzeugs in jeder Projektphase – quasi das virtuelle Pendant zum realen Fahrzeug im Computermodell. Dieses Computermodell kann vielfältig gestaltet werden. Es kann zunächst ein konzeptionelles Modell mit reiner Systemsimulation sein oder das, was man als 1D-Simulation bezeichnet. Das kann später die Form sehr detaillierter CFD-Berechnungen oder eines präzisen CFD-Modells annehmen. Und letztlich kann es auch ein testbasiertes Modell sein – lediglich eine Abbildung der Testdaten.
Steven Dom:
All dies sind auf Wunsch digitale Zwillinge. Behauptet man, es gäbe nur einen digitalen Zwilling? Nun, es könnte einen digitalen Zwilling geben, der ein Modell oder die Realität am treffendsten abbildet.
Alexander Heintzel:
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wird die Simulation oder der digitale Zwilling den Test nicht ersetzen. Vielmehr wird es in Zukunft eine Wechselwirkung zwischen digitalem Zwilling und realem Test geben, da dies, wie Sie sagten, nur die Realität zu einem bestimmten Zeitpunkt im Entwicklungsprozess darstellt.
Steven Dom:
Ja. Es ist die bestmögliche Abbildung der Realität, wie wir sie zu diesem Entwicklungsstand kennen oder wahrnehmen, würde ich sagen. Es gibt eindeutig den Trend, schon früher im Entwicklungsprozess mehr zu erreichen. Hier spielt die Simulation natürlich die Hauptrolle: Wir wollen möglichst früh in der Fahrzeugentwicklung die Realität so umfassend wie möglich mittels Computermodellen abbilden. Das stimmt schon, aber warum eigentlich? Das ist ganz einfach. Sie wollen Probleme nicht erst in der Endphase beheben.
Steven Dom:
Das ist eine Botschaft, die wir schon hören und diskutieren, seit ich als Konstrukteur tätig bin. Vor 25 Jahren sagten wir bereits: „Wir müssen früher aktiv werden.“ Tatsache ist: Mit fortschreitender Technologie können wir immer früher im Entwicklungsprozess mehr simulieren, und dieser Trend wird sich fortsetzen. Dieser Traum kennt keine Grenzen, solange der Wille vorhanden ist.
Steven Dom:
Das Endziel mancher Firmen: alles simulieren, nichts mehr testen. Allerdings sehen wir das möglicherweise anders. Mit ein paar Jahren Erfahrung unter dem Gürtel, was Tom?
Tom Van Houcke:
Mm-hmm (bejahend).
Steven Dom:
In diesem Sinne können Sie nicht immer alles simulieren, vor allem angesichts neuer Technologien und Konzepte, die in die Fahrzeugentwicklung einfließen.
Alexander Heintzel:
Tom, teilen Sie die Ansicht Ihres Kollegen, oder sehen Sie in Zukunft weiteres Potenzial bei diesem Thema? Wo liegen Ihrer Meinung nach die Grenzen?
Tom Van Houcke:
Nun, es gibt definitiv mehr Chancen, und das wird sogar, meiner Meinung nach, durch zwei Entwicklungen noch verstärkt. Zunächst gibt es keine Beschränkungen mehr bei Datensammlung und -speicherung. Erstausrüster erkennen, dass sie über umfangreiche historische Daten, Testdaten und Daten aus genutzten Fahrzeugen verfügen. Diese können durch maschinelles Lernen aufgewertet und genutzt werden, um Modelle – insbesondere testbasierte Modelle – zu erstellen, die den Zusammenhang zwischen Fahrzeugeigenschaften und Leistungsverhalten definieren. Das ist gewissermaßen eine Weiterentwicklung. Andererseits wird es mit steigender Rechenleistung möglich sein, noch umfangreichere digitale Zwillinge in Echtzeit zu betreiben und diese mit Tests zu kombinieren. Und nicht nur während der Entwicklungsphase, sondern auch später im Fahrzeugeinsatz, sodass Controller und Aktoren durch aktuelle Modelle und Daten optimiert werden können – selbst wenn das Fahrzeug bereits auf dem Markt und in Betrieb ist.
Steven Dom:
Ja, es geht um das Konzept der Endlosschleife, das aufkommt und die Idee vorantreibt, dass der V-Zyklus nicht einfach endet, sondern weiterläuft. Dabei werden Modelle im Fahrzeug genutzt und tatsächlich angewendet. Und während des Gebrauchs und je nach Fahrweise lässt sich das Fahrzeug sogar kontinuierlich verbessern. Ich komme darauf zurück, dass Sie selbstverständlich die Möglichkeit haben, beispielsweise die Steuerungssoftware des Fahrzeugs während der Nutzung zu ändern und Updates anzubieten.
Alexander Heintzel:
Sie erwähnten soeben das kontinuierlich lernende Fahrzeug, auch während des Fahrvorgangs beim Kunden. Um dies bereitzustellen, ist ein gewisses Maß an KI erforderlich. Derzeit herrscht in manchen Bereichen ein regelrechter KI-Hype. Stimmen Sie diesem Hype zu, oder sagen Sie eher: „KI ist nur ein Werkzeug wie viele andere. Es hat Vorteile, ist aber stets nur so gut wie der Entwickler.“ Oder wie sehen Sie das?
Tom Van Houcke:
Ja, im Grunde genommen stimmt das. In der Tat ist KI ein Werkzeug, doch man sollte genau wissen, was man damit macht. Sie sollten wissen, was Sie eingeben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Tom Van Houcke:
Um ein Beispiel zu nennen: Wie erwähnt, wird den Erstausrüstern – also den Unternehmen – bewusst, dass sie über einen reichen Fundus an historischen Daten verfügen. Historische Daten Zahlreiche Benchmarking-Daten, doch wie setzt man diese sinnvoll ein? Nun, es gibt hier drei Voraussetzungen. Zunächst gilt es, die Daten richtig zu speichern und zu kennzeichnen, um sie wiederverwenden zu können. Es lässt sich vergleichen. Zweitens ist das Know-how im Bereich maschinelles Lernen essenziell, um die optimale Methode zur Datennutzung anzuwenden. Und drittens, und das ist am wichtigsten, brauchen Sie Anwendungskompetenz. Sie sollten wissen, welche Merkmale in der Entwicklung und Datenbank als Eingabegrundlage Ihre Konstruktion maßgeblich charakterisieren.
Tom Van Houcke:
Wenn man nichts Ordentliches eingibt, kommt nur Müll heraus. Angenommen, Sie beschreiben Ihr Fahrzeug. Sie interessieren sich für die NVH-Eigenschaften und beziehen dabei auch die Autofarbe mit ein. Möglicherweise zeigt das Ergebnis, dass das rote Auto stets leiser ist. Nun, das ist doch völlig unlogisch. Andererseits spielen Radstand, Reifenmerkmale und Ähnliches eine wichtige Rolle.
Tom Van Houcke:
Und das ist noch nicht alles. Maschinelles Lernen kann weit mehr als nur historische Daten auswerten. Sie könnten sich auch daran erinnern, dass wir über diesen umfassenden digitalen Zwilling sprachen. Nun, wie lässt sich das im laufenden Betrieb nutzen und zur Optimierung des Controllers einsetzen? Das ist derzeit mit dem vollständigen digitalen Zwilling nicht machbar, aber Sie können Machine-Learning-Technologien einsetzen, um Ihre Modelle zu vereinfachen und durch neuronale Netze zu ersetzen. Ein neuronales Netz liefert im Grunde die Beziehung zwischen Ein- und Ausgabe, was für den Betrieb und die Optimierung der Steuerung oftmals genügt.
Steven Dom:
Im Grunde sagen Sie also, Tom, dass Sie ein Modell des Fahrzeugs ins Fahrzeug selbst integrieren.
Tom Van Houcke:
Ja, ja. Tatsächlich. Das ist richtig.
Steven Dom:
Das ist cool.
Tom Van Houcke:
Darüber hinaus sehen wir, dass maschinelles Lernen Sie während der Entwicklung in der Software unterstützen kann, indem es Expertenempfehlungen gibt. Als nächsten Schritt zeigt es, welche Analyse anschließend in der Entwicklung durchzuführen wäre oder – falls Ihre Konstruktion die Ziele verfehlt – was Sie tun oder wo Sie ansetzen müssen, um Ihre Konstruktion zielgerecht zu optimieren. Hier ein weiteres konkretes Beispiel: KI kann zur Definition menschenähnlichen Fahrverhaltens genutzt werden. Dies unterstützt die Entwicklung autonomer Fahrzeuge und könnte deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit erhöhen.
Alexander Heintzel:
Nun. Die meisten Menschen haben heutzutage keine automatischen Funktionen in ihren Autos, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich möchte nun auf einen weiteren Aspekt eingehen: die System- und Prozessintegration, die unmittelbar mit unserem vorherigen Thema verknüpft ist. Fahrzeugsysteme sind zunehmend miteinander vernetzt, wie wir drei wissen. Sie sind integriert. Wie lässt sich das handhaben und welche Herausforderungen entstehen dabei? Ich meine, das ist gar nicht so einfach, oder? Steven?
Steven Dom:
Tatsächlich ein sehr guter Punkt, denn mit zunehmender Komplexität der Fahrzeuge … Ich blicke gerne zurück auf die alte Schule und betrachte Autos von vor 20 oder 30 Jahren, bei denen die Systeme noch weitgehend voneinander getrennt waren. Ich meine, Sie hatten einen Verbrennungsmotor und vermutlich einige Bedienelemente dafür. Und selbst wenn man etwas zurückblickt, fehlten jegliche Kontrollen. Man hatte bloß Taschenrechner, mehr nicht. Und Vollgas, klar Tom? Sie verfügen über ein Schaltgetriebe mit Kupplung. Alle diese Systeme waren völlig voneinander losgelöst. Klar, sie waren verbunden, um das Auto anzutreiben, hatten aber kaum Wechselwirkungen untereinander. Ich vergleiche das gern mit etwas Alltäglichem oder zunehmend Üblichem, um die Gegensätze bzw. die Entwicklung aufzuzeigen.
Steven Dom:
Und das zeigt sich am Beispiel eines E-Antriebssystems. Sie haben also einen Elektromotor, ein Getriebe und die Leistungselektronik – alles kompakt in einer einzigen Einheit integriert. Es ist nicht mehr so, dass jemand nur für die Elektromagnetik des Motors oder nur für das Getriebe zuständig ist. Und vielleicht ist es nur ein simples Getriebe mit einer Übersetzung, aber dennoch bleibt es ein Getriebe. Und dann die zum Elektromotor gehörige Leistungselektronik, wobei beide völlig unabhängig voneinander arbeiten können. Ich meine, es gibt viele verschiedene Systeme, aber es ist ein offensichtliches Beispiel dafür, dass Experten aus verschiedenen Domänen eng zusammenarbeiten müssen, um eine effiziente Einheit für sich oder als integrierte Komponente zu schaffen.
Steven Dom:
Und es gibt zahlreiche Beispiele am Markt – ohne Namen zu nennen –, wo die Zusammenarbeit offensichtlich nicht optimal umgesetzt wurde. Nur einen Blick aufs Kühlsystem werfen. Ich meine, Ihr Elektromotor muss gekühlt werden. Ihr Getriebe und Ihre Leistungselektronik benötigen eine Kühlung. Wenn dieses Kühlsystem als Gesamtsystem konzipiert und gebaut wird, wobei alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt werden, musste der Wärmetechnik-Konstrukteur mit allen drei Hauptkomponenten zusammenarbeiten: dem Elektronik-, Getriebe- und Elektromagnetik-Experten. Aber wenn er das alles zusammen erledigt und diese Kooperation gelingt, kann er ein effizientes integriertes Kühlsystem konstruieren. Allerdings gibt es auf dem Markt noch Fahrzeuge mit getrennten Kühlsystemen.
Steven Dom:
Und du fragst dich … Der Elektroniker hatte die Kühlung, ein Experte aus der Thermikabteilung stellte die richtige Kühlung seines Teils sicher, der Getriebefachmann ebenso, und der Elektromotorspezialist genauso. Am Ende lande ich bei drei Kühlsystemen, obwohl ein einziges System vermutlich besser geeignet wäre, die Aufgabe bewältigen und deutlich effizienter arbeiten könnte. Auch am Markt zeigt sich dies bei Fahrzeugen mit deutlich tiefgreifender Integration solcher Systeme.
Steven Dom:
Und wenn man es genauer betrachtet, sogar die Klimaanlage des Fahrzeugs. Die Klimaanlage in diesem Auto benötigt ebenfalls einen Kühl- oder kombinierten Heiz-/Kühlkreislauf. Verbindet man diese Elemente jedoch und optimiert sie als Gesamtsystem, lässt sich eine deutlich höhere Effizienz erzielen. Das führt dazu, dass die Komplexität eine wesentlich engere und effizientere Zusammenarbeit erfordert.
Alexander Heintzel:
Das ist ein gutes Argument. Technisch betrachtet müssen wir eindeutig effizienter werden. Wir müssen uns optimieren, um diese Produkte zu marktgerechten Preisen anbieten zu können. Aber was heißt das konkret für den Ablauf? Und für die Organisation der Entwicklung? Ich meine, traditionell arbeiten Autohersteller in Silos.
Steven Dom:
Im Silo.
Alexander Heintzel:
Diese Abteilung macht den Motor, jene das Interieur, diese die Elektronik, und es braucht Leute, die alles koordinieren. Ich glaube, das könnte künftig zu kurz greifen. Welche „prozessualen“ und organisatorischen Veränderungen sind Ihrer Meinung nach für die Zukunft erforderlich?
Steven Dom:
Nun, wenn ich ergänzen darf: Ein Trend, den wir heute oft bei unseren Kunden beobachten, ist das Aufkommen von Konzepten wie Systems Engineering. Diese Methodik verknüpft Anforderungen und deren detaillierte Beschreibung mit Funktionen, die auf globaler Ebene umgesetzt und dann auf verschiedene Subsysteme heruntergebrochen werden. Dabei entsteht ein Prozess, der Verifizierungsmanagement und -aktivitäten mit jeder Funktion verbindet und alle Anforderungen in einem gründlichen Verfahren validiert. Dies wurde ursprünglich in der Luft- und Raumfahrtbranche etabliert, wo man dies schon lange, anfangs noch papierbasiert, bei Raumfahrtprogrammen praktizierte. Und ich weiß, es geht um die Automobilindustrie, aber in dieser Welt war die Vernetzung der Systeme schon viel früher sichtbar und zum Thema geworden als in der Automobilbranche.
Steven Dom:
Und nun sehen wir in der Automobilindustrie viele sogenannte Schlagworte wie „modellbasiertes Systems Engineering“ und „modellbasierte Entwicklung“. Unsere Kunden versuchen, ähnliche Ideen und Konzepte in ihre Entwicklungsprozesse zu integrieren, um diese Vernetzung zu fördern. Aber ganz so leicht ist es keineswegs.
Tom Van Houcke:
Nein, das ist nicht so einfach. Jeder weiß, dass man diesen Weg einschlagen muss, doch wie tauscht man die erforderlichen Daten und letztendlich die Modelle aus? Sie möchten, dass jede Abteilung und jeder Verantwortliche für einen Fahrzeugteil Zugriff auf alle relevanten Informationen hat – und zwar in geeigneter Form. Ich meine, wenn Sie für die Ausrüstung das Risiko tragen, dann ist das Ihr Aufgabenbereich. Sie benötigen dort sämtliche Details, für die angeschlossenen Komponenten reicht es jedoch, deren Auswirkungen auf die Vorgänge im Getriebe zu kennen.
Tom Van Houcke:
Man benötigt demnach den passenden Ablauf, um dies umzusetzen: den Austausch von Modellen und Informationen. Daher benötigt man als Grundlage ein solides System, ein effektives Werkzeug zur Verbesserung.
Alexander Heintzel:
Nun. Fahren Sie fort.
Steven Dom:
Die passende Komponente des PLM- oder Prozessmanagementsystems. Es ist unerheblich, wie man es bezeichnet, aber es geht um die Möglichkeiten, Werkzeuge und Prozesse, die ineinandergreifen. Der Prozess ist zwar am wichtigsten, doch die Werkzeuge sind unerlässlich, um ihn zu unterstützen und so Kooperationen zu ermöglichen, bei denen ein Laie aus einer Domäne die von Experten einer anderen Domäne erstellten Modelle nutzen kann.
Steven Dom:
Damit Sie von Anfang an systemübergreifend denken können, statt sich auf eine Domäne oder ein einzelnes Attribut zu beschränken. Ich kann als Lärm- und Schwingungskonstrukteur arbeiten, aber heutzutage habe ich in dieser Rolle – um ein einfaches Beispiel zu nennen – möglicherweise … Früher verfügte ich über Methoden, um Masse oder Dämpfung hinzuzufügen und so bestimmte Geräuschmerkmale zu reduzieren. Aber jetzt könnte ich auch mit einem Steuerungs-Konstrukteur zusammenarbeiten. Vielleicht habe ich ein Antriebsruckeln, das durch das Zusammenspiel von Getriebe und Motor entsteht. Durch Anpassung der Motor-Steuerelektronik könnte ich dieses Ruckeln reduzieren, ohne mechanische Änderungen vornehmen zu müssen. Man sollte es als Zusammenarbeit betrachten. Und es erweitert auch den Blickwinkel der verschiedenen Konstrukteure in gewisser Weise.
Alexander Heintzel:
Wenn man diesen Gedanken weiterführt, gibt es nur noch vollelektrische Fahrzeuge. Wir benötigen kein Getriebe, da ein Elektromotor ohne Gangschaltung auskommt. Jedes Fahrzeug ist mit elektronischer Lenkung, -Antrieb und -Bremse ausgestattet. Jedes Auto erreicht Automatisierungs-Level 3 oder 4 beim autonomen Fahren.
Alexander Heintzel:
In diesem Fall: Bleibt ein BMW ein BMW, ein Ferrari ein Ferrari, ein Golf ein Golf? Möglicherweise ist der Golf kein gutes Beispiel, wer kauft schon einen? Aus Leiderschaft. Nun gut, sprechen wir über die Zukunft der Markenabgrenzung. Welche neuen geistigen Eigentumsrechte werden Ihrer Meinung nach künftig Marken voneinander abheben? Angesichts der soeben dargelegten Tatsache.
Steven Dom:
Nun. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Frage. Und die Antwort ist nicht eindeutig, sondern eher differenziert. Wie differenzieren Sie Ihre Marke im Bereich autonomer Fahrzeuge? Wenn wir von Elektrofahrzeugen reden, bleibt meiner Meinung nach das Fahrerlebnis erhalten. Und wie du schon sagtest, die BMW-DNA bleibt erhalten [German 00:21:14]. Das zeigt sich auch in den Bewertungen. Ohne Werbung für BMW machen zu wollen, aber I4-Fahrer sagen: „Er fährt sich wie ein BMW“ – und das ist positiv. Ich denke, wenn wir die Anwendererfahrung betrachten, das Menschen im Auto haben werden, bleibt dies der Hauptfaktor für die Markendifferenzierung. Sie werden weiterhin … Und das ist eine Herausforderung für die Erstausrüster: Sie müssen sicherstellen, dass sich ein Mercedes beim Einsteigen wie ein Mercedes anfühlt. Und ein Golf, tja, vielleicht sollte der in Kurven immer noch das innere Rad anheben, oder? Das war generationenlang ein Markenzeichen des Golf. Sie sind damit flotter unterwegs als mit dem Golf.
Alexander Heintzel:
Ich hab gerade einen, ja.
Steven Dom:
Beim Fahren hebt sich das innere Hinterrad vom Boden ab. Das war ein Teil dessen, was den Golf zum Golf machte. Ich bin mir sicher, dass Konstrukteure das über Generationen hinweg eingebaut haben. Nie offiziell bestätigt, aber es war einfach so.
Steven Dom:
Das Anwendererlebnis wird daher entscheidend sein. Und Sie sehen, auch die verschiedenen Erstausrüster überlegen intensiv, wie sie sich differenzieren können. Wie gestalte ich die Anwendererfahrung im Fahrzeuginnenraum so, dass sie meine persönliche Note trägt? Für autonome Fahrzeuge dürfte diese Herausforderung noch größer sein, da man dann nur Passagier ist, nicht wahr?
Tom Van Houcke:
Ja, genau das haben sie schon angedeutet. Sie sind nur ein Beifahrer. Wie sollte es sich denn anfühlen? Sollte sich das Auto noch genauso anfühlen wie beim manuellen Fahren?
Steven Dom:
Hey, guter Punkt. Wenn es autonome Rolls Royce gibt, sollten die dann wie fliegende Teppiche sein? Und soll ein BMW autonom so sportlich fahren wie sein Ruf?
Alexander Heintzel:
Mm-hmm (bejahend).
Steven Dom:
Meinen Sie ...
Alexander Heintzel:
Akzeptieren die Kunden das? Was Sie gerade angesprochen haben, besonders Tom, über vollautonome Fahrzeuge – also Level 5, bei dem man nur Fahrgast ist – könnte meiner Meinung nach auch schon für Level 4 gelten. Glauben Sie, dass die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI, Human Machine Interface) künftig eine viel größere Rolle bei der Markenunterscheidung spielen wird, um das passende Fahrgefühl zu vermitteln?
Steven Dom:
Auf jeden Fall. Ich denke, wie gesagt, die Interaktion mit dem Fahrzeug wird letztlich das Alleinstellungsmerkmal der Marke ausmachen. Wie Sie mit dem Fahrzeug interagieren und wie es seine Identität und seinen Charakter Ihnen gegenüber definiert. Und das HMI ist Teil davon, ebenso wie das Fahrverhalten. Ich denke, das HMI ist ein wichtiger Aspekt. Gerade beim autonomen Fahren wird man zwar eher Passagier sein, aber entscheidend sind auch das Fahrzeugverhalten, der Komfort und die Art des Komforts, die man erleben wird. Ich denke, Tom spielte damit auf dieses menschenähnliche Fahren an.
Tom Van Houcke:
Nun. Es wird heute viel erforscht, wie Menschen Auto fahren. Aber die Frage ist, ob das so bleibt – vermutlich nicht, doch darauf sind wir noch nicht vorbereitet. Der Markt ist dafür noch nicht reif. Wir haben erlebt, wie lange es dauerte, bis insbesondere der europäische Markt Automatikgetriebe annahm. Und autonome Fahrzeuge haben noch einen langen Weg vor sich. Sicherheit hat oberste Priorität, aber er muss sich auch angenehm anfühlen. Die Menschen müssen dem Auto das Steuer überlassen. [crosstalk 00:25:59].
Alexander Heintzel:
Eigentlich sind es ja nur
Steven Dom:
80 % der Menschen ... Und angeblich schalten 80 % der Fahrer all diese Zusatzfunktionen in ihrem Auto ab. Dann stellt sich die Frage: Wenn es jeder abschaltet, hat der Erstausrüster offenbar noch viel Arbeit vor sich, um die nötige Akzeptanz dafür zu schaffen. Und ganz ehrlich, ich hab sie abgeschaltet. Das gebe ich gerne zu. Ich sage nicht, welches Auto ich fahre.
Alexander Heintzel:
Seit Kurzem gibt es das erste Auto mit Fahrassistenz auf Level 3 auf dem Weltmarkt: die Mercedes S-Klasse im Luxussegment. Wie Sie erwähnten, wird es für Otto Normalverbraucher noch eine Weile dauern, bis sie das selbst erleben können. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Fragen. Wie bereiten wir den Markt vor? Wie bereiten wir Markt und Kunden optimal vor? Denn die meisten Kunden verfügen nicht einmal über einen adaptiven Tempomaten. Wie bereiten wir sie und den Markt auf Level 3, 4 und 5 vor, um diese Fahrzeuge absetzen zu können?
Steven Dom:
Ich denke, der entscheidende Punkt wird sein, sie zu überzeugen. Es geht nicht nur um die Vorbereitung, sondern darum, sie wirklich von der Akzeptanz zu überzeugen. Wie Sie erwähnten, deaktivieren 80 % der Autofahrer diese Funktionen in ihren Fahrzeugen. Es findet also keine Akzeptanz. Die Vorbereitung davon
Tom Van Houcke:
Es erfolgt keine Abnahme, da die Kundenwünsche unklar sind. Wir kennen die Kundenerwartungen nicht. Sie denken, natürlich möchte der Kunde auch sicher fahren, und die heutigen automatisierten Funktionen sorgen dafür, dass die Fahrt sicherer wird, dennoch akzeptieren Sie es nicht.
Steven Dom:
Ja.
Tom Van Houcke:
Weil es nicht exakt Ihren Vorstellungen entspricht. Zunächst müssen wir die Kundenerwartungen genau erfassen, bevor wir den nächsten Schritt gehen können.
Steven Dom:
Ich denke, Sie haben vollkommen recht. Und das bereitet den Markt gewissermaßen vor. Es geht darum zu verstehen, wie Fahrer tatsächlich bereit werden, die Kontrolle abzugeben und loszulassen. Und die Tatsache, dass einige dieser Funktionen nun unerwartet, aber vermutlich auf sichere Weise agieren. Das Verhalten des Autos ist nicht unbedingt unsicher, entspricht aber nicht den Erwartungen von Fahrer oder Beifahrer. Dies führt dazu, dass das autonome Fahren unterbrochen wird oder zumindest keine Korrektureingriffe erfolgen.
Tom Van Houcke:
Aber ich denke, das gehört dazu … Anfangs war es cool, etwas zu automatisieren, und die Erstausrüster haben dies mit Schwerpunkt auf Sicherheit umgesetzt. Es war zwar cool, diese automatisierten Funktionen und Fahrerassistenzsysteme zu haben, doch später wurde klar: Die Leute nutzen sie nicht, weil sie nicht ihren Erwartungen entsprechen. Ich würde sagen, es ist ein sich entwickelnder Erkenntnisprozess.
Tom Van Houcke:
Sehen Sie, anfangs drehte sich alles um die Frage: Wie automatisieren wir das Fahrzeug? Wie lässt sich eine Funktion automatisieren? Wie erhöhen wir die Sicherheit? „Sicherheit“ stand im Mittelpunkt, sowohl bei autonomen Fahrzeugen als auch bei der Automatisierung bestimmter Funktionen in Elektroautos. Aber wir beobachten einen Wandel in der Wahrnehmung. Jetzt ist uns klar, dass wir den Kunden einbeziehen müssen. Wenn wir ihre Nutzung fördern wollen, müssen wir ihre Bedürfnisse kennen. Es geht nicht nur um Sicherheit, sondern um die Balance mit Komfort. Es muss mit der Anwendererfahrung in Balance stehen.
Steven Dom:
Auf jeden Fall.
Alexander Heintzel:
Manchmal hören Sie Experten sagen: „Wir springen einfach direkt von Level 2 auf Level 4 oder 5.“ „Level 3 brauchen wir nicht.“ Wenn man also davon ausgeht, was Sie gerade gesagt haben, glauben Sie eher an die Evolution als an die Revolution. Sie würden also nicht empfehlen, Level zu überspringen, da die meisten Kunden heutzutage Schwierigkeiten haben, dies zu akzeptieren.
Steven Dom:
Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht wäre es möglich, wenn ihr umgehend ein Level-5-Fahrzeug bereitstellen könntet. Vielleicht käme die Akzeptanz schneller, da man nicht mehr selbst ins Fahren eingreifen würde. Das Auto würde einfach das machen, was es ohnehin tut, stimmt’s? Sie haben die Bestätigung von der Fertigung oder der Regierung, die bescheinigt, dass der Betrieb des Fahrzeugs sicher ist und Sie keine weitere Verantwortung tragen. Oder Sie fühlen sich einfach nicht mehr verantwortlich. Und ich glaube, das würde die Einstellung der Menschen grundlegend ändern.
Steven Dom:
Andererseits ist der evolutionäre Ansatz offensichtlich der Weg, den es nehmen wird, da alle Autohersteller autonome Fahrfunktionen implementieren werden, sobald diese verfügbar sind – denn das ist eindeutig der richtige Weg. Aus Marketingsicht verweigert man Kunden keine Fuktionen im Auto, nur weil man meint, sie seien noch nicht dafür bereit.
Steven Dom:
Es geht auch darum, „der Erste zu sein, der“ – sagen wir bei Mercedes – „ein Level-3-Fahrzeug auf den Markt bringt.“ Naja, okay. Autonomes Fahrfahrzeug auf Level 3, das von Mercedes vermarktet wird. Das verleiht ihnen ein gewisses Ansehen, was folgerichtig und angemessen ist. Das ist aus Mercedes-Sicht absolut nachvollziehbar.
Steven Dom:
Ich bin sicher, dass wir in etwa 10 Jahren – ich sage nur 10 Jahre – Level 3, 4 und schließlich 5 erreichen werden. Mit Level 5 fünf meine ich den höchsten Level der Automatisierung. Ich kann nicht vorhersagen, wann genau Nutzfahrzeuge mit vollständiger Autonomie auf den Markt kommen werden. Technisch wäre es vermutlich früher möglich, aber aus gesetzgeberischer Sicht gibt es noch Hürden und dergleichen. Mal sehen, wann es soweit ist, aber die Autohersteller werden solche Funktionen auf jeden Fall einführen, sobald sie verfügbar sind. Auch aus rein kommerzieller Sicht ist dies notwendig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dabei zurückhalten würden.
Tom Van Houcke:
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich um eine Evolution oder Revolution handeln würde. Sobald man den Weg zu vollautomatisierten Fahrzeugen einschlägt, stellt sich die Frage: Braucht man dann überhaupt noch ein eigenes Auto? Oder bewegen wir uns jetzt in Richtung geteilter Mobilitäten? Ich gehe davon aus, dass manche Städte bereits Schritte zur Einführung eines solchen Systems unternehmen. Und dann kann man nicht einfach einigen erlauben, diesen Weg einzuschlagen. Dann denken Sie Mobilität völlig neu.
Tom Van Houcke:
Und das ist etwas … Wir Erstausrüster sprechen ungern darüber, aber es ist definitiv ein Thema, über das wir nachdenken müssen und das neue Möglichkeiten eröffnet. Ich denke, das könnte auch ein Weg sein, die Vorherrschaft des Autos zu akzeptieren, wenn man die Möglichkeiten ohne Besitz erkennt. Nicht jeder braucht ein eigenes Auto, aber es erfordert eine komplette Neugestaltung von Infrastruktur und Mobilität.
Steven Dom:
Das trifft es auf den Punkt. Und tatsächlich denken die meisten Erstausrüster darüber nach, wie sie – oder das Automobilunternehmen – in einer Shared-Mobility-Umgebung relevant bleiben können. Und ich denke, es gibt noch etliche offene Fragen in diesem Bereich. Dann stellt sich die Frage: Wie vermittelt man Markenidentität bei Shared Mobility, wenn das Fahrgefühl einer bestimmten Marke nicht mehr im Vordergrund steht? Dann stellt diese Markenidentität sozusagen eine weitere Frageebene dar, eine zusätzliche Dimension der Ungewissheit. Will ich wirklich … Ich meine, warum sollte ich im Bereich der geteilten Mobilität extra zahlen, um selbst zu fahren oder von einem Mercedes statt einer Mittelklassemarke abgeholt zu werden? Das ist eine berechtigte Frage, aber ich kann sie leider nicht beantworten.
Alexander Heintzel:
Ich glaube, keiner von uns kennt die Antwort. Würden Sie abschließend zustimmen, dass künftig Kriterien wie Leistung und Handhabung in den Hintergrund treten, während Komfort und Zuverlässigkeit relevant bleiben und neue Aspekte wie Konnektivität und Anwenderschnittstelle die Kaufentscheidung für ein bestimmtes Modell maßgeblich beeinflussen werden? Knappe Antwort.
Steven Dom:
Nun.
Tom Van Houcke:
Knappe Antwort. Ja, ja.
Steven Dom:
Die kurze Antwort ist eindeutig ja. Ich meine, Leistung … wenn das Auto autonom fährt, spielen Leistung und Handling doch keine Rolle mehr, oder? Das Auto muss das bewältigen, doch Sie werden sich um den Fahrkomfort sorgen. Das ist klar. Ich meine, man möchte sich im Auto wohlfühlen, denn ich denke auch an Zuverlässigkeit. Besonders wenn man weiter in die Zukunft blickt, wie Tom es bei Shared Mobility erwähnte, werden Zuverlässigkeit und Lebensdauer plötzlich wichtiger. Früher sagten Konstrukteure: „Okay, wir bauen ein Auto für 170.000 bis 200.000 Kilometer, danach darf es versagen.“ Das wird sich ändern. Stellen Sie sich ein Gemeinschaftsfahrzeug vor, das täglich nicht bloß 50, sondern tausend Kilometer zurücklegt. Ich denke nicht, dass Sie etwas ändern möchten, und es wäre wohl kaum akzeptabel, diese Fahrzeuge nach nur etwa drei Monaten bereits auszumustern. Nur eine Spinnerei, aber Sie sollten diese Aspekte in dem Kontext bedenken.
Alexander Heintzel:
Meine Herren, Steven und Tom, vielen Dank für dieses angenehme Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, und auch allen Zuhörern dieses Podcasts. Vielen Dank. Bleiben Sie sicher. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.

Alexander Heintzel, Chefredakteur bei ATZ International – Moderator
Dr. Alexander Heintzel ist Chefredakteur der führenden Fachzeitschriften für Konstrukteure im Bereich der Motoren-, Automobil- und Elektronikindustrie: ATZ, MTZ, ATZelectronics und ATZheavy duty, die weltweit auf Englisch und Deutsch erscheinen. Er moderiert die ATZ-Podcast-Reihe „Talk on Technology“ und ist eng mit ATZlive-Konferenzen für die Konstrukteure der Automobilindustrie vernetzt.

Steven Dom, Director Automotive Industry Solutions bei Simcenter – Gast
Mit über 20 Jahren Erfahrung im Ingenieurwesen hat Steven in verschiedenen Bereichen gearbeitet, wie zum Beispiel im Engineering, Engineering Management, Produktmanagement und im Vertrieb. Aktuell ist er Leiter für Lösungen in der Automobilbranche. In dieser Rolle unterstützt Steven Erstausrüster und Zulieferer bei der Entwicklung einer strategischen Roadmap für Software, Hardware und Dienstleistungen sowie Kundentechnologie und Geschäftsprozessberatung. Darüber hinaus ist er Berater für die Entwicklung von Hybrid-und Elektrofahrzeugen.

Tom Van Houcke, Direktor Simcenter Engineering Services – Gast
Seit 2003 unterstützt Tom weltweit Fahrzeughersteller und Zulieferer bei diversen Konstruktionsaufgaben. Er bringt 20 Jahre Engineering-Know-how für Lösungen und Technologien in verschiedenen Bereichen wie NVH und Akustik, Fahrbarkeit und Fahrdynamik mit. In seiner aktuellen Position leitet er das Kompetenzzentrum für Performance-Engineering, das Simulation und Erprobung vereint. Mit Schwerpunkt auf Technologie-Innovationsprojekten treibt er die Automobilbranche bei der Entwicklung elektrifizierter und autonomer Fahrzeuge voran.